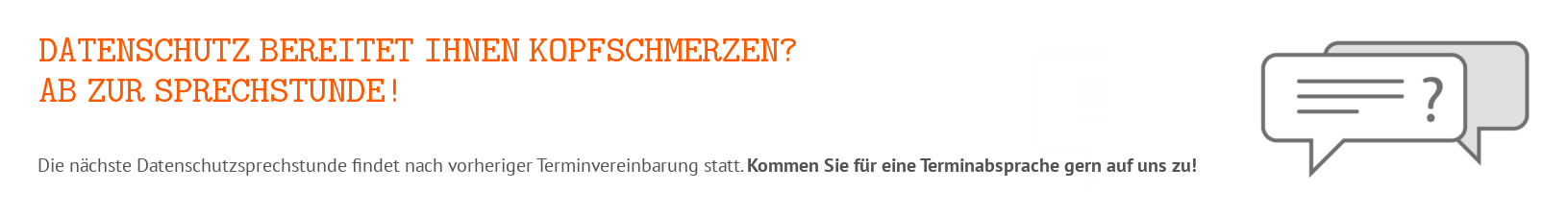
Im Rahmen der Blog-Reihe „Ein Spaziergang durch die DS-GVO“ betrachten wir die einzelnen Artikel der Datenschutz-Grundverordnung aus einem etwas anderen Blickwinkel. Ziel ist kein x-ter Kommentar, es soll eher ein Datenschutz-Feuilleton entstehen, mit Anmerkungen und Überlegungen auch zu Artikeln, die Sie im Datenschutz-Alltag vielleicht noch nie gelesen haben. Nach der kurzen letzten Etappe gibt es jetzt wieder ordentlich etwas „wegzuwandern“.
Ein Recht auf Vergessenwerden?
Artikel 17 zieht sich in die Länge, vor allem weil der Gesetzgeber den Wanderweg wieder in großen Schleifen angelegt hat. Absatz 1 und Absatz 3 könnte man zusammenfassen: „Betroffene können von Verantwortlichen die sofortige Löschung ihrer personenbezogenen Daten verlangen, wenn eine Rechtsgrundlage für die weitere Speicherung fehlt.“
Aber der Reihe nach: Schon die Überschrift enthält sprachlich eine „seltene Orchidee“. Das „Recht auf Vergessenwerden“ kann man Stars und Sternchen, A-, B- und C-Prominenten sowie Influencern wahrscheinlich gar nicht erklären. Wer will schon vergessen werden? Vermutlich führt der Begriff auch andere betroffene Personen, zum Beispiel Kinder und Jugendliche, nur in die Irre und sollte deshalb selbst schnell vergessen werden. Es gibt kein durchsetzbares (!) Recht auf Vergessenwerden und erzieherisch wertvoller als dieser einlullende, trügerische Begriff bleibt allemal die Erkenntnis „Das Internet vergisst nicht.“ Wie beim ökologischen Fußabdruck müssen Betroffene auch beim „data foot print“ zuallererst auf die eigenen „Emissionen“ achten und sollten sich nicht darauf verlassen, dass anschließend Andere den (Daten-)Abfall sauber wegräumen.
„Recht auf Vergessenwerden“ soll originell klingen, ist aber nur albern. Halten wir uns lieber an das „Recht auf Löschung“.
Absatz 1
In Absatz 1 wird es sehr lang abgehandelt. Wie schon erwähnt, lassen sich die dort aufgelisteten Einzelfälle zusammenfassen: Gelöscht werden muss, wenn eine Rechtsgrundlage für die weitere Speicherung fehlt. Der Anspruch auf Löschung bei der betroffenen Person ist dabei immer das Spiegelbild zur Löschpflicht des Verantwortlichen.
Absatz 2
Absatz 2 möchte erreichen, dass der Verantwortliche den Löschauftrag genauso weitergibt, wie er zuvor die personenbezogenen Daten weitergegeben hat. In der Praxis ist die Vorschrift zwar nicht gänzlich bedeutungslos, aber Betroffene sollten sich über die Erfolgsquote keinen Illusionen hingeben: Veröffentlichungen lassen sich selten oder nie rückgängig machen. Hilfreicher ist manchmal ein Effekt, den die DS-GVO gar nicht in Betracht zieht: Die Daten von heute werden zugedeckt durch die Daten von morgen.
Absatz 3
Absatz 3 regelt sehr umständlich Ausnahmen von den Löschpflichten aus Absatz 1 und 2, nämlich genau solche Fälle, in denen eben doch noch eine Rechtsgrundlage zur weiteren Speicherung besteht.
Geht es auch ein bisschen kürzer?
Die Abkürzung zum verschlungenen Wanderweg durch Artikel 17 könnte also beispielsweise insgesamt lauten:
„Recht auf Löschung“
(1) Betroffene können von Verantwortlichen die unverzügliche Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen, sobald eine Rechtsgrundlage zur weiteren Speicherung fehlt.
(2) Haben Verantwortliche die betreffenden Daten an Dritte weitergegeben, bei denen vermutlich die Rechtsgrundlage zur Speicherung ebenfalls entfallen ist, sollen sie das Löschverlangen mitteilen.Es geht sogar noch kürzer: Der zweite Absatz ist ganz verzichtbar, wenn man Artikel 19 anschaut. Aber laufen wir erst einmal zum achtzehnten Meilenstein…
Über den Autor: Prof. Dr. Ralph Wagner ist Vorstand des DID Dresdner Institut für Datenschutz sowie Vorsitzender des ERFA-Kreis Sachsen der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD). Als Honorarprofessor an der Technischen Universität Dresden hält er regelmäßig Vorlesungen und Seminare zum Thema Datenschutzrecht. Für Anregungen und Reaktionen zu diesem Beitrag können Sie den Autor gern per E-Mail kontaktieren.




