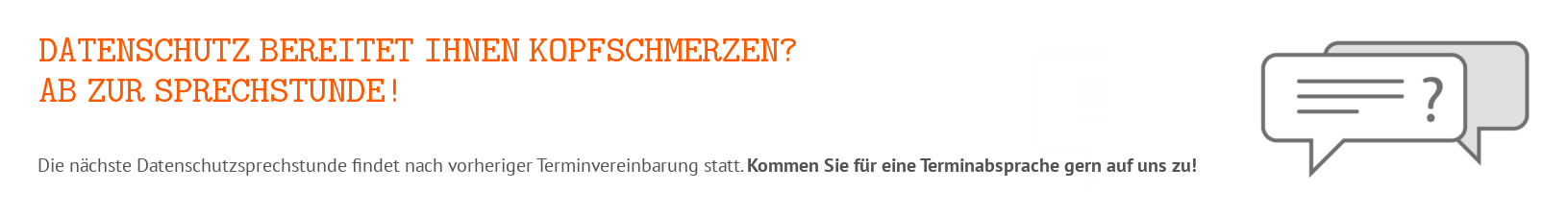
Im Rahmen der Blog-Reihe „Ein Spaziergang durch die DS-GVO“ betrachten wir die einzelnen Artikel der Datenschutz-Grundverordnung aus einem etwas anderen Blickwinkel. Ziel ist kein x-ter Kommentar, es soll eher ein Datenschutz-Feuilleton entstehen, mit Anmerkungen und Überlegungen auch zu Artikeln, die Sie im Datenschutz-Alltag vielleicht noch nie gelesen haben. Wer den Artikel 21 liest – und dafür ist der Spaziergang ja gedacht – fragt sich vielleicht: „Habe ich mich verlaufen? Sind wir hier nicht schon vorbeigekommen?“ Tatsächlich ist die Landschaft dem Artikel 18 zum Verwechseln ähnlich. Es wäre möglich – und sinnvoll? – beide Vorschriften zu verbinden. Laufen wir das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 ab:
Was beinhaltet Artikel 21?
Absatz 1 gibt das Recht zum Widerspruch für Datenverarbeitungen im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt sowie aufgrund eines berechtigten Interesses, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) und f) DS-GVO. Voraussetzung sind Gründe der Betroffenen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, also einfach Umstände des Einzelfalls. Weiter verarbeitet werden dürfen die Daten dann nur noch, wenn der Verantwortliche zwingende schutzwürdige Gründe nachweisen kann oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
Absätze 2 und 3 klären, dass bei Datenverarbeitung für Direktwerbung die Betroffenen jederzeit widersprechen können – also auch ohne besondere Einzelfall-Umstände – und dieser Widerspruch die Direktwerbung in jedem Fall verbietet – also ohne weitere Interessenabwägung. Absatz 4 verlangt entsprechende Hinweise an die Betroffenen – seltsamerweise zusätzlich zu Artikel 13 Abs. 2 lit. b) und Artikel 14 Abs. 2 lit. c) DS-GVO in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form. Warum und wie von anderen Informationen getrennt? Absatz 5 provoziert die Rätselfrage: Gibt es automatisierte Verfahren, bei denen keine technischen Spezifikationen verwendet werden? Ich kenne keine.
Und Absatz 6 erlaubt – auch außerhalb von Einwilligung und Vertrag, also weitergehend als Absatz 1 – bei der Datenverarbeitung zu statistischen Zwecken und Forschungszwecken den Widerspruch, „es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich“. Wie so oft ist die DS-GVO auch hier wieder wunderbar unpräzise, umständlich und rätselhaft:
- Was ist Folge des Widerspruchs nach Absatz 6? Wahrscheinlich ein Verarbeitungsverbot, genau wie in Absatz 1 Satz 2. Das wird nur nicht gesagt.
- Darf dann trotzdem für andere Zwecke weiter verarbeitet werden, wenn die Anforderungen aus Absatz 1 Satz 2 erfüllt sind? Wahrscheinlich ja, es wird nur nicht gesagt.
- Artikel 89 DS-GVO regelt ja insgesamt nur Verarbeitungen, die im öffentlichen Interesse liegen. Wann soll dann ein Widerspruch nach Absatz 6 überhaupt wirksam sein? Wenn er doch bei öffentlichem Interesse nicht gilt? Hier wäre der Wanderleiter dankbar für Hinweise aus der Gruppe.
In der Praxis ist das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO fast bedeutungslos. Wie andere Betroffenenrechte auch, wurde es sehr kompliziert konstruiert. Vielleicht wollte der Gesetzgeber den Betroffenen möglichst viele Rechte geben. Aber wie das Sprichwort weiß: Manchmal ist weniger mehr. Mit den Ansprüchen auf Auskunft und Löschung nach Art. 15 und 17 DS-GVO dürfte alles Wesentliche erreichbar sein.
Zur Verständlichkeit
„Fun-Fact“ zum Abschluss der heutigen Etappe: Die DS-GVO betont und verlangt immer wieder einfache, klare, präzise und leicht verständliche Sprache. Es gibt inzwischen wissenschaftlich etablierte Tools, mit denen Lesbarkeit bzw. Verständlichkeit recht gut beurteilt werden können. Und natürlich lassen sich diese Tools auch auf die DS-GVO anwenden.
Das funktioniert zum Beispiel beim sogenannten „Flesch-Index“ (nicht „Flash“). Er bewertet in der üblichen Skalierung Texte mit 0 bis 100 Punkten, wobei hohe Punktzahlen eine leichte Verständlichkeit bedeuten. 0 bis 30 Punkte stehen für sehr schwer verständliche Texte. Die DS-GVO erreicht bei meinen Versuchen – egal in welcher Sprache und auch in kleineren Abschnitten – keine Werte oberhalb von 25. Die ersten 99 Paragrafen des Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) schaffen immerhin einen Flesch-Wert von 41 . Das deutsche Einkommensteuergesetz liegt mit §§ 1 bis 10 (das sind deutlich mehr als 10 Paragrafen) bei 27. Datenschutzgesetze sind also fast so klar und leicht verständlich wie das Steuerrecht…
Über den Autor: Prof. Dr. Ralph Wagner ist Vorstand des DID Dresdner Institut für Datenschutz sowie Vorsitzender des ERFA-Kreis Sachsen der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD). Als Honorarprofessor an der Technischen Universität Dresden hält er regelmäßig Vorlesungen und Seminare zum Thema Datenschutzrecht. Für Anregungen und Reaktionen zu diesem Beitrag können Sie den Autor gern per E-Mail kontaktieren.




