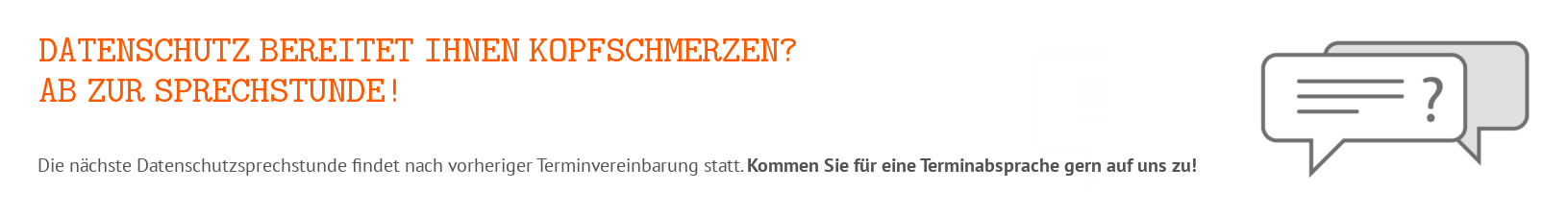
Vermutlich löst kaum eine andere Norm der Datenschutz-Grundverordnung bei der praktischen Umsetzung vergleichbar Unbehagen bei den verantwortlichen Stellen aus wie der Auskunftsanspruch nach Art. 15 DS-GVO. Man stelle sich nur vor, welche Gedanken den intern Verantwortlichen durch den Kopf gehen, wenn plötzlich ein – vielleicht sogar anwaltliches –Schreiben eingeht, in welchem vollständige Auskunft über die personenbezogenen Daten der betroffenen Person verlangt wird. Mit den möglichen Anforderungen an die Auskunftserteilung haben wir uns erst neulich bei einem Spaziergang durch die DS-GVO befasst. Im heutigen Beitrag wollen wir den Blick ein stückweit auf die Rechtsfolgenseite richten und uns mit der Frag beschäftigten, was passiert, wenn die Auskunft zu spät erteilt wird.
… unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats…
Grundsätzlich gilt auch für die Auskunftserteilung die Frist des Art. 12 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO: „Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 22 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung.“ Man könnte nun durchaus darüber diskutieren, ob mit „ergriffene Maßnahme“ im Falle von Art. 15 DS-GVO die vollständige Auskunftserteilung gemeint ist, aber dies wollen wir heute nicht betrachten, da es für unseren Fall auch nicht wirklich entscheidend ist (wir haben bereits über die Thematik berichtet).
Es bleibt also bei der in Datenschutzkreisen wohl bekannten Frist „unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats„. Der „wunderbare“ unbestimmte Rechtsbegriff unverzüglich kann dabei wohl nach herrschender Meinung vergleichbar zu § 121 Bürgerliches Gesetzbuch also „ohne schuldhaftes Zögern“ verstanden werden. Hervorzuheben ist, dass „innerhalb eines Monats“ als Höchst- und nicht als Regelfrist zu verstehen ist. Nach Art. 12 Abs. 3 Satz 2 DS-GVO kann die Frist „[…] um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist.“
Die Frage die sich nunmehr aufdrängt ist, wie weiter zu verfahren ist, wenn die erforderliche Auskunft nicht innerhalb der gesetzlichen Frist erfüllt wird und ob der jeweils betroffenen Person ein Schadenersatzanspruch gemäß Art. 82 DS-GVO zusteht.
Schadenersatz als Kontrollverlust?
Mit der geschildeten Situation hat sich jüngst das Bundesarbeitsgericht (BAG) in seinem Urteil vom 20. Februar 2025 (Az.: 8 AZR 61/24) auseinandergesetzt. In einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung forderte der Kläger und ehemaliger Beschäftigter der Beklagten im Oktober 2022 Auskunft, nachdem er bereits 2020 Auskunft über die Ihn betreffenden personenbezogenen Daten erhalten hatte. Die Auskunft wurde ihm letztendlich nach mehreren fruchtlosen Fristsetzungen im Dezember 2022 erteilt. Nach Ansicht des Klägers allerdings unvollständig. Deshalb verlangte der Kläger Schadenersatz nach Art. 82 DS-GVO. In der Vorinstanz wurde ihm vom Arbeitsgericht Duisburg zunächst ein Anspruch in Höhe von 10.000€ zugesprochen (wir berichteten), bevor das Landesarbeitsgericht Düsseldorf das Urteil wiederrum aufhob und die Revision zum BAG zuließ.
Das BAG urteilte nun, dass allein eine verspätete Auskunft noch keinen Schadenersatzanspruch nach Art. 82 DS-GVO begründet. Vielmehr sei die Darlegung eines entsprechenden Schadens seitens des Klägers – dieser behauptete hier schlicht einen Kontrollverlust – erforderlich: „Die vom Kläger im vorliegenden Rechtsstreit geschilderte Gefühlslage begründet demnach keinen Schaden im Zusammenhang mit einem Kontrollverlust. Der Kläger hat – wovon das Landesarbeitsgericht zu Recht ausgegangen ist – keine konkreten Befürchtungen einer missbräuchlichen Verwendung seiner Daten dargelegt.“
Fast schon schulbuchartig prüft das BAG die durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in verschiedenen Urteilen (wir berichteten hier, hier, hier und hier) statuierte Anwendung des Art. 82 DS-GVO. Zunächst stellt das BAG heraus, dass der Anspruch nach Art. 82 DS-GVO das Vorliegen eines Schadens, eines Verstoßes sowie eines Kausalzusammenhangs zwischen Schaden und Verstoß erfordert.
Hierfür wird herausgestellt: „Hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast ist geklärt, dass die Person, die auf der Grundlage von Art. 82 Abs. 1 DSGVO den Ersatz eines immateriellen Schadens verlangt, nicht nur den Verstoß gegen Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung nachweisen muss, sondern auch, dass ihr durch diesen Verstoß ein solcher Schaden entstanden ist.“ Und weiter: „Der – selbst kurzzeitige – Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten kann einen immateriellen Schaden iSv. Art. 82 Abs. 1 DSGVO darstellen, der einen Schadenersatzanspruch begründet, sofern die betroffene Person den Nachweis erbringt, dass sie tatsächlich einen solchen Schaden – so geringfügig er auch sein mag – erlitten hat […].“
Vorliegend aber konnte ein solcher Kontrollverlust durch den Kläger gerade nicht dargelegt werden: „Die durch einen Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung ausgelöste Befürchtung einer betroffenen Person, ihre personenbezogenen Daten könnten von Dritten missbräuchlich verwendet werden, kann für sich genommen einen immateriellen Schaden iSv. Art. 82 Abs. 1 DSGVO darstellen […]. Das rein hypothetische Risiko der missbräuchlichen Verwendung durch einen unbefugten Dritten kann jedoch nicht zu einer Entschädigung führen […].“
Das BAG kommt daher zum Ergebnis: „Das bloße Berufen auf eine bestimmte Gefühlslage reicht dabei nicht aus […] Eine nur verspätete Auskunft begründet demgegenüber für sich genommen keinen Kontrollverlust über Daten iSd. Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung, sondern nur einen Zeitverzug hinsichtlich der Auskunft.“
Oder doch aufgrund negativer Gefühle?
Anschließend befasst sich das BAG noch mit der Frage, ob der Schaden in Form von negativen Gefühlen wegen der verspäteten Erfüllung des Auskunftsanspruchs vorliegt und lehnt auch dies zu recht ab: „Ein immaterieller Schaden kann allein in negativen Gefühlen bestehen […]. Die verspätete Erfüllung des Auskunftsanspruchs löst geradezu zwangsläufig die Sorge eines Verstoßes gegen sonstige Verpflichtungen aus der Datenschutz-Grundverordnung aus […]. Wäre schon das Berufen auf solche abstrakten Befürchtungen ausreichend für die Annahme eines Schadens, würde jeder Verstoß gegen Art. 15 DSGVO – so ein Verstoß dagegen einen Schadenersatzanspruch nach Art. 82 Abs. 1 DSGVO dem Grunde nach begründen könnte – zu einem immateriellen Schaden führen. Die eigenständige Voraussetzung des Schadens würde damit bedeutungslos […].“
Ergänzt sei noch, dass das BAG hingegen die Frage offengelassen hat, ob eine potenzielle Verletzung von Art. 15 DS-GVO in Verbindung mit Art. 12 Abs. 3 DS-GVO überhaupt einen Verstoß im Sinne des Art. 82 Abs. 1 DS-GVO darstellen kann.
Fazit
Das BAG entschied in seinem Urteil, dass eine verspätete Auskunft allein keinen Schadenersatzanspruch begründet. Dies bedeutet für Betroffene jedoch nicht, dass mögliche Ansprüche nach Art. 82 DS-GVO in Gänze ausgeschlossen wären. In der Praxis wird entscheidend sein, das der gelten gemachte Schaden zum Beispiel in Form eines Kontrollverlustes zumindest nachvollziehbar dargelegt und eine missbräuchliche Verwendung bewiesen wird. Das bloße Abstellen auf die verspätete Auskunftserteilung ist hingegen nicht ausreichend.
Über den Autor: Alexander Weidenhammer ist Rechtsanwalt und als externer Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragter beim Dresdner Institut für Datenschutz tätig. Im Fokus seiner Beratungstätigkeiten liegen insbesondere Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien, mittelständische Unternehmen sowie Vereine. Für Anregungen und Reaktionen zu diesem Beitrag können Sie den Autor gern per E-Mail kontaktieren.




